(20) Die Triton-Passage
€6,99
Mark Brandis, Band 20
Ebook, 168 Seiten, Format Epub
Kategorie: Mark Brandis
Schlagwörter: Mark Brandis, Michalewski, Weltraumabenteuer
John Harris setzt alles auf eine Karte: Mit einem Experimentalschiff und einer fremden Crew schickt er Mark Brandis zum Neptun, um dort nach einem verschollenen VOR-Schiff mit 100 Menschen an Bord zu suchen. Wegen der angespannten politischen Situation und der Angst der Asiaten, ihr Gesicht zu verlieren, kam die Bitte um Hilfe viel zu spät, und es besteht kaum noch Hoffnung, Überlebende bergen zu können.
Falls Mark Brandis keinen Erfolg haben sollte, so weiß Harris, ist seine Karriere als VEGA-Direktor ein- für allemal beendet.
Schreiben Sie die erste Bewertung für „(20) Die Triton-Passage“ Antworten abbrechen
Kapitel 01
Im klaren Licht der Morgenfrühe des 3. Mai des Jahres 2083 erhob sich der silberne Rumpf der Diana wie eine Verheißung ungetrübten Urlaubsglücks vor der großen Sonne, die den Schaumkranz der Brandung in rubinrot perlenden Champagner verwandelte.
Ich hatte das Schiff gegen alle Vernunft und Regeln der Sparsamkeit für volle drei Monate gechartert. Frischer Wind strich vom Atlantik her über das Rampengelände der VEGA; er überzog, bevor er klirrend und pfeifend weiterstürmte zu den gläsernen Türmen und himmelhohen Betonzinnen der 50-Millionen-Stadt Metropolis, die Cockpitscheiben mit einer grauweißen Salzkruste. Auf den Lippen hinterließ er den Geschmack von Freiheit und Abenteuer und allen Wundern dieser Erde.
Eine Stunde zuvor hatte mir die Transglobe Inc. die Diana vertragsgemäß auf den Platz gestellt, nachdem die VEGA, zu deren fliegendem Personal ich gehörte, für die Bürgschaft aufgekommen war. Nun nahm ich sie in Augenschein. Für zwei Personen, die sich anschickten, einen Bummel rund um den heimatlichen Planeten zu machen – vielleicht auch mit einem Abstecher in lunare Gefilde –, war sie das geeignete Schiff: schnell, sparsam und hinreichend geräumig. Und eben diese letzte Eigenschaft hatte, als Ruth O‘Hara und ich uns nach einem passenden Urlaubsgefährt umsahen, den Ausschlag gegeben.
Ruth hatte sich vorgenommen, mit großem Gepäck zu reisen, um für alles gerüstet zu sein: für das einfache Strandleben ebenso wie für die Glitzerhöllen des Spielerparadieses Las Lunas und, nicht zu vergessen, für den glanzvollen Ball im Palast des australischen Hochkommissars in Sydney, zu dem wir – weiß der Kuckuck, woher diese Ehre – eine auf altmodischem Büttenpapier gedruckte Einladung erhalten hatten.
Als ich an diesem frühen Maimorgen aus dem Transporter kletterte, der mich zu den Rampen hinausgebracht hatte, geschah dies mit einem Gefühl des Unwirklichen. Zu lange schon hatten Ruth und ich uns auf diesen gemeinsamen Urlaub gefreut, und noch im buchstäblich letzten Augenblick hatte es alle Phantasie und Überredungskunst gekostet, um unsere beider Ferientermine auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Der Fahrer des Transporters, ein grauköpfiger Mann in verschlissenem VEGA-Overall, Otto Schulz mit Namen, gab sich väterlich.
»So ist‘s recht, Commander. Urlaub muß sein. Der Mensch kann schließlich nicht immer im Dienst sein. Wohin soll‘s denn gehen?«
»Was würden Sie von der Südsee halten?«
Otto Schulz verdrehte sehnsüchtig die Augen.
»Mann, o Mann! Palmen, weiße Strände, braungebrannte Hulahulamädchen. Unsereins kennt das ja nur vom Fernsehen – aber ich sehe schon, Sir, Sie packen das richtig an.«
Ich lachte. »Lassen Sie die Hulahulamädchen besser unerwähnt, wenn Sie gleich meine Frau holen. Es könnte sonst sein, daß sie mich zum Nordpol dirigiert – und kalte Füße habe ich mir unter den Sternen schon mehr als genug geholt.«
Otto Schulz seufzte. Wahrscheinlich dachte er an Jugendträume. »Das will ich glauben, Sir. Ich stell mir das verflucht ungemütlich da oben vor. Andererseits – wenn Sie auf einer Ihrer Reisen mal wen brauchen könnten, der Ihnen die Bude in Ordnung hält und auch mal was kochen kann ...«
Bei der ganzen VEGA gab es nicht einen Commander, bei dem sich Otto Schulz nicht bereits beworben hätte. Und wir alle wußten, was ihn am Boden hielt.
»Haben Sie mit Ihrer Frau schon darüber gesprochen?«
Er winkte verdrossen ab.
»Das ist es ja. Sie läßt mich nicht. Keine Phantasie, verstehen Sie, Sir. Aber sonst ist sie ja in Ordnung.« Otto Schulz legte zwei Finger an die Mütze und zwängte sich wieder auf den Fahrersitz. »Dann will ich mal die Frau Gemahlin holen und das Gepäck.«
Der Transporter setzte sich fauchend in Bewegung und wich gleich darauf auf die Grassoden aus, um Captain Millers knallrotem offenem Sportcoupe Platz zu machen.
Als Captain Miller, genannt der Lord, an mir vorüberzog, grüßte er mit reservierter Höflichkeit – ein stattlicher Mann mit grauen Schläfen, die ihn im Zusammenklang mit seinem jugendlich gebliebenen Gesicht und seinen untadeligen Manieren, so das Gerücht, für gewisse Ehefrauen in Kollegenkreisen unwiderstehlich machten.
Bei Ruth O‘Hara freilich war er abgeblitzt.
Captain Miller hielt nicht an, sondern nahm Kurs quer über das Gelände zu den astralen Rampen, auf denen sich der schlanke, zierliche Rumpf der Explorator abzeichnete.
Zurück blieben eine Staubwolke und ein fader Geschmack.
Miller hatte es nie verwunden, daß ich ihn, obwohl wir dem gleichen Jahrgang angehörten, auf der Rangskala der VEGA überholt hatte. Einmal hatte er im Kasino die Andeutung fallen lassen, daß es bei meiner Ernennung zum Commander wohl nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen sei. Ich war darüber stillschweigend hinweggegangen, wohl wissend, daß es wieder einmal der Alkohol gewesen war, der Miller zu dieser ebenso unüberlegten wie unbegründeten Äußerung hingerissen hatte. Miller jedoch fuhr fort, mir zu grollen.
Ich schüttelte die Verstimmung ab, die so gar nicht zu diesem herrlichen Morgen paßte, enterte die Steigleiter hoch und betrat das Schiff.
Ich fand nichts zu beanstanden. Die Treibstoffbunker waren randvoll gefüllt, und nachdem ich den Vorstarter gedrückt und die Armaturen aufgescheucht hatte, wanderte mein Blick über lauter einwandfreie Anzeigen. Die Transglobe Inc. hatte mir, wie angekündigt, ihren besten Mittelstreckenrenner auf den Platz gestellt.
Eine Viertelstunde war ich damit beschäftigt, den Kurs zu bestimmen, wobei ich mir vornahm, nach Möglichkeit auf Sicht zu fliegen und unterhalb der Schallgrenze zu bleiben.
Als ich schließlich das Kartenmaterial aus der Hand legte, war auch Otto Schulz mit dem Transporter erneut im Anrollen, und ich konnte Ruth O‘Haras rotes Haar im Wind wehen sehen.
Der Graukopf reichte mir die Koffer zu, ich verstaute sie hinter den Sitzen, und dann kam strahlend und leichtfüßig Ruth O‘Hara selbst an Bord geklettert und fiel mir um den Hals.
»Mark, ich kann‘s einfach nicht glauben! Ein Vierteljahr lang nur du und ich.«
Selten hatte ich sie so aufgeregt erlebt. Man mußte sie verstehen. Wie oft schon hatten wir diesen Urlaub geplant – und immer war etwas dazwischengekommen: eine Kommandierung, ein Auftrag, ein Job, der mich hinausführte in die Welt der Sterne, während sie in Metropolis zurückblieb, zum Warten verurteilt, auch wenn ihr Beruf sie ausfüllte.
Behutsam löste ich Ruth O‘Haras Arme von meinem Hals.
»Ein Vierteljahr minus eine Minute!« sagte ich. »Und wenn du mich nicht gleich losläßt, sind es bald minus zwei. Ruth, der Tower wartet, daß wir den Platz räumen.«
»Laß ihn warten!« sagte Ruth. »Desto gründlicher ist er uns dann los.«
Immerhin zwängte sie sich gehorsam in ihren Sitz und legte die Gurte an. Ich verriegelte den Einstieg und fuhr die Steigleiter ein – und nun erst fiel das beseligende Begreifen über mich her, daß wir in der Tat bereits so gut wie unterwegs waren: Ruth und ich. Ein volles Vierteljahr auf der Erde, die ich immer seltener zu sehen bekam; ein volles Vierteljahr ohne dienstliche Verpflichtungen, ohne Testflüge, ohne Expeditionen unter fremden, unerforschten Sternen. Drei unvorstellbar köstliche Monate lang würde ich an Ruths Seite die würzige Luft dieser Erde atmen, an die man in der kalten Einsamkeit des Raumes, eingepfercht in eine zerbrechliche Hülle aus Metall und Kunststoff, unter tausend Sehnsüchten zurückdachte.
Das Triebwerk sprang an und brachte die Diana zum Vibrieren.
»Also dann!« sagte ich. »Wohin darf die Reise gehen?« Ruth lehnte ihren Kopf gegen meine Schulter.
»Wohin du willst, Mark«, erwiderte sie. »Hauptsache, wir haben endlich einmal Zeit füreinander.«
Während das Triebwerk warmlief, ließ ich den Blick über das Rampengelände wandern, vor dem die atlantische Brandung schäumte. Im Schein der Morgensonne hatte sich Metropolis in eine feurige Fata Morgana verwandelt. Hunderttausende, Millionen von Fenstern warfen das Licht zurück. Es war ein grandioses Abschiedsfest. »Ruth, hast du Harris etwas davon gesagt, wohin wir fliegen?«
»Nein. Du?«
»Um Himmels Willen!« sagte ich. »Wir verschwinden einfach von der Bildfläche als unbekannt verzogen. Falls er auf die Idee kommen sollte, mich aufstöbern zu wollen, wird er eine Armee von Hellsehern benötigen. Ich bin im Urlaub.«
Das Triebwerk hatte sich warmgelaufen und hörte auf zu rütteln. Ich rief den Tower.
»Tower – Diana zwo-zwo-zwo. Ich bin klar zum Start. Wenn Sie mich freigeben, mache ich mich jetzt aus dem Staub.«
Mike Bergers sonore Stimme erklang im Lautsprecher. »Meinen Glückwunsch zu deinen zweiten Flitterwochen, Mark! Weißt du schon, wann ihr wieder zurück sein wollt?«
Ich tauschte einen Blick mit Ruth. »Überhaupt nicht, Mike. Wir verkriechen uns auf einer einsamen Insel und verbuddeln die Diana im Sand.«
Bergers Lachen brachte den Lautsprecher zum Scheppern. »Na großartig, Mark! Genau so muß man‘s halten – sonst holt einen der verdammte Streß doch wieder ein. Also, von mir aus – haut ab! Steigwinkel siebzig auf neunzig.«
»Siebzig auf neunzig. Roger. Mach‘s gut, Mike!«
»Das gleiche für dich und Ruth, Mark, und bleibt gesund. Und jetzt verschwindet! Da hängt so ein VOR-Schlitten in der Luft und will rein.«
»Der größte Vorzug der Asiaten ist seit je her die Geduld«, erwiderte ich. »Was will ein VOR-Schlitten in Metropolis? Sag‘ bloß nicht, das Jahrtausend der Brüderlichkeit sei angebrochen.«
Der Lautsprecher schepperte erneut.
»Auf Raten, Mark, auf Raten! Alles, was ich weiß, ist, daß die Strategische Raumflotte Order bekommen hat, ihn ungeschoren zu lassen. Also, was ist – meldest du dich ab?«
»Gemacht, Mike!« sagte ich. »Wir wollen den Schlitten nicht warten lassen. Diana zwo-zwo-zwo meldet sich ab.«
Einen Atemzug später waren wir unterwegs.
Die Diana stieg. Sie stieg, wie es der Tower ihr vorgeschrieben hatte: mit einem Winkel von siebzig Grad in genau östlicher Richtung – dem großen roten Feuerball über dem Atlantischen Ozean entgegen.
Sie stieg leicht, rasch und mühelos.
Sie stieg hindurch durch einen Schwarm kreisender Möwen und warf für einen flüchtigen Augenblick ihren langen Schatten über das Gelände.
»Mark!«
Ruth schrie.
Aus den Augenwinkeln hatte ich den gelben Blitz bereits erspäht, der aus dem seidigen Blau auf uns herabstieß.
Es war zu spät, um ihm auszuweichen.
Alles, was ich am Steuer noch tun konnte, um zu verhindern, daß er uns wie eine Granate voll in die Seite krachte, war eine halbe Drehung nach Backbord.
Der gelbe Blitz schrammte mit ohrenbetäubendem Getöse an unserem Heck entlang – und für den Bruchteil einer Sekunde sah ich im Spiegel ein fremdes Cockpit –, dann war die Diana auf einmal nicht mehr zu halten.
In Augenblicken wie diesen begreift man sofort; man begreift mit nahezu hellsichtiger Klarheit. Jemand hatte Mist gebaut: entweder Mike Berger im Tower oder der Pilot des VOR-Schlittens, der viel zu früh und noch dazu auf ungehörigem Kurs zur Landung angesetzt hatte. Vierhundert Meter über dem Atlantik waren die beiden Schiffe miteinander zusammengestoßen.
Ein Unfall, wie er nicht vorkommen darf.
Ein Unfall, wie er doch immer wieder vorkommt.
Der VOR-Schlitten – wahrscheinlich ein Sampan – war nicht mehr zu sehen. Ich hatte anderes zu tun, als mich um ihn zu kümmern. Das Triebwerk setzte aus, sprang wieder an, setzte aus. Es war ein Alptraum.
Irgendwie gelang es mir, die Diana auf Westkurs zu legen. Das Rampengelände der VEGA raste auf das Cockpit zu. Mit etwas Glück mußte es mir gelingen, das lädierte Schiff aufzusetzen.
Das Triebwerk sprang wieder an, aber die Steuerwirkung war gleich null. Die Diana geriet mir aus der Hand und raste mit der Sturheit eines angreifenden Stieres auf das Hauptgebäude zu. Ich weiß bis auf den Tag nicht, wie ich es anstellte, sie noch einmal in die Höhe zu zwingen, bevor sie sich in die verspiegelte Fassade bohren konnte.
Zwei Kilometer hinter dem Hauptgebäude krachte sie auf das Dach eines Hangars, prallte wieder ab, überschlug sich und raste mit dem Heck voraus in einen der Reparaturschuppen.
Als ich wieder zu mir kam, hing ich mit dem Kopf nach unten in den Gurten, und um mich herum wütete ein wahnsinniger Stummfilm. Das Schiff brannte – aber es war ein Bild, zu dem der Ton fehlte. Meine Ohren waren noch zu sehr betäubt, um das Prasseln und Fauchen der Flammen wahrzunehmen.
Daß es nicht schlimmer gekommen war, hatten wir lediglich dem Schuppen zu verdanken, der den Aufprall gedämpft hatte: weiches, elastisches Material – Kunststoff und gestapelte Kisten.
»Ruth!«
Sie gab keine Antwort. Mit wächsernem Gesicht hing sie neben mir schlaff in den Gurten.
»Ruth, komm zu dir! Ruth! Wir müssen hier raus! Ruth!«
Auf einmal war mein Gehör wieder da.
Ich hörte meine eigene Stimme und Ruths totengleiches Schweigen, und ich hörte das laute Prasseln der Flammen, die sich als quirlender roter Wall an das Cockpit heranfraßen. Die Luft schmeckte nach Rauch; die Luft schmeckte nach verschmorten Kunststoffen. Ich keuchte und hustete und war am Ersticken. Die Augen schmerzten, die Lungen schmerzten. Es war heiß wie in der Hölle.
Mein Gurt ließ sich öffnen. Ich ließ mich fallen. Heißes Metall versengte mir die Schulter. Ich stemmte mich hoch. Es ging um Sekunden.
Ruths Gurt hatte sich verklemmt. Der Verschluß ließ sich nicht öffnen.
Wo zum Teufel blieb die Feuerwehr?
Tausend Augenpaare mußten den Absturz beobachtet haben – von Mike Berger im Tower ganz zu schweigen. Halb blind, halb erstickt, suchte ich nach dem Messer. Es war da, wo es zu sein hatte, griffbereit in meiner rechten Oberschenkeltasche.
Die Klinge sprang auf, und ich säbelte an Ruths Gurt, bis das zähe Material endlich nachgab und Ruth mir auf die Schulter kippte.
Eine Wand aus Schaum fiel über die Diana her. Die Feuerwehr war endlich zur Stelle. Schwere Brechstangen traten in Aktion und hebelten den Lukendeckel des Einstiegs auf. Ich vernahm Stimmen.
»Hierher, Commander!«
Das Schiff lag auf dem Rücken. Mit Ruth auf der Schulter kämpfte ich mich durch die Trümmer, durch Glut, Rauch und ätzende Gase hinaus ins Freie. Rings um die Diana hatten die Schaumkanonen einen feuerfreien Ring gelegt.
Männer der Brandbrigade in hitzefesten Asbestanzügen fingen mich auf.
»Sind Sie verletzt, Commander?«
Ich konnte nur noch röcheln.
»Meine Frau ...«
Die Feuerwehrmänner griffen zu und nahmen mir die Last von den Schultern.
Ein Lautsprecher brüllte.
»Raus aus dem Schuppen! Raus! Alles sofort raus!«
Die Männer der Brandbrigade zerrten mich hinaus ins Freie. Zwischen ihren Fäusten krümmte ich mich und rang noch immer nach Luft.
Vor meinen tränenden, schmerzenden Augen formten sich verschwommene erste Bilder.
Ruth O‘Hara lag auf der Trage, die in die bereitstehende Ambulanz geschoben wurde. Ihre Augen waren geschlossen. Zwischen ihren Lippen steckte das Mundstück eines Beatmungsgerätes, gehalten von der Hand eines Sanitäters.
Meine Eingeweide verkrampften sich. Es war mir gleich, daß ich selbst davongekommen war. Nur daß Ruth am Leben blieb war wichtig.
Ich sah vertraute Gesichter über vertrauten Uniformen – aber ich hatte keinen Blick für sie.
»Am besten ist, Sie fahren gleich mit, Commander«, hörte ich sagen.
Jemand quetschte meine zerschundene Hand.
»Nur damit Sie‘s wissen, Sir – wir alle sind Zeugen. Sie trifft keine Schuld. Es war dieser verfluchte VOR-Sampan ...«
Ich schüttelte die Hände ab, die mich zum Überleben beglückwünschten, die Arme, die mich noch immer stützten, und zwängte mich hinter der Trage in die Ambulanz. Die Tür fiel zu, und die Ambulanz stob davon.
Ich saß neben dem Notarzt auf der plastikbezogenen Bank, hielt Ruths Hand und betete.
Die Ambulanz zickzackte über das Rampengelände und nahm Kurs auf das Haupttor, und für die Dauer eines Atemzuges sah ich auf dem Platz den gelben Sampan stehen, der an allem schuld war. Er war glimpflich davongekommen. Auf den ersten Blick wirkte er unbeschädigt.
Ähnliche Produkte
Mark Brandis
€6,99
Mark Brandis
€6,99
Mark Brandis
€12,00
Mark Brandis
€6,99
Mark Brandis
€12,00
Mark Brandis
€12,00
Mark Brandis
€6,99
Mark Brandis
€12,00






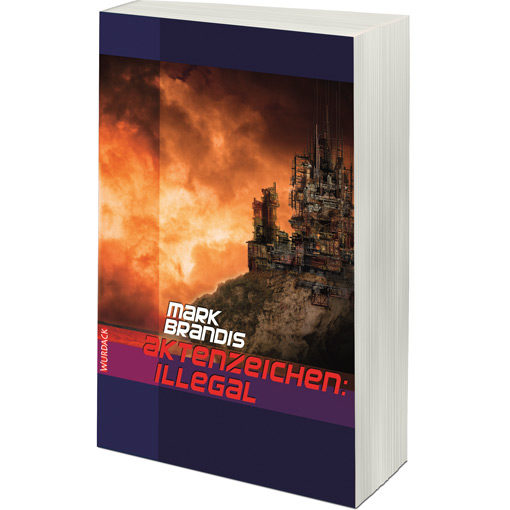




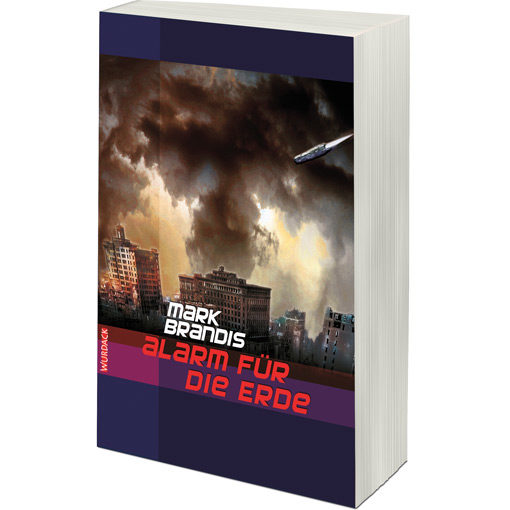
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.