Lügenvögel
€12,95
Karla Schmidt – Lügenvögel
Hardcover, 148 Seiten
Ein makelloses kleines Vogelei steckt in Marias Kopf. Seit es da ist, schreibt sie zwanghaft jeden Fetzen Papier voll, muss alles protokollieren, was ihr widerfährt. Doch entsprechen ihre Erinnerungen der Realität? Maria tritt eine Reise ins Dickicht der Vergangenheit an und begegnet den menschengesichtigen Lügenvögeln, die ihr zuflüstern, wie anders alles war und sein wird …
Lügenvögel erzählt von der Unzuverlässigkeit des Universums, von Wirklichkeiten, die nicht mit und nicht ohne einander auskommen, und von einer Kindheit im Schatten der Tschernobyl-Katastrophe.
Schreiben Sie die erste Bewertung für „Lügenvögel“ Antworten abbrechen
Das kann keine Sehstörung sein. Dafür ist es zu vollkommen schwarz. Mir wird das Geräusch des Motors bewusst, das Echo der Reifen auf dem Asphalt schwappt träge im Dunkel hin und her. Ich schalte das Licht ein. Tunnelwände treten aus dem Nichts hervor.
"Es sieht aus, als hätten wir hier eine Art Raumforderung."
Doktor Sandmann hat das sehr beiläufig gesagt, als ich bei ihm in der Praxis gesessen habe. Ich glaube nicht, dass er gefühllos klingen wollte. Er war bloß hilflos, weil er nicht wusste, was das ist, dieses Ding in meinem Kopf.
Ich trete aufs Gas, aber es sieht nicht so aus, als würde ich bald wieder hier rauskommen. Vielleicht ist das so eine Geschichte, in der jemand in einen Tunnel fährt und fährt und fährt und es kein Ende gibt. Falls ja, nehme ich einfach einen andern Weg. Einfach nur kurz das Steuer verreißen, ist ganz leicht.
Nicht dass ich sterben will, wer will schon Sterblichkeit, und ich will auch nicht begraben, verbrannt oder verstreut werden, aber ich kann das doch nicht einfach diesem Ding in meinem Kopf überlassen. Für solche Entscheidungen braucht man Abstand und Überblick.
Zu den Symptomen gehören allerlei Sehstörungen: perspektivische
Verschiebungen, Sichtfeldausfälle, Flimmerskotom. Besonders das letzte ist nervenaufreibend, weil man dabei auf schwer zu
begreifende Weise aus der Wirklichkeit fällt. Man schaut, man weiß, es fehlt etwas, da ist eine Lücke, ohne dass man sagen könnte, was fehlt und wo genau sich die Lücke befindet. Man kann sich nicht einmal daran erinnern, wie es ist, wenn die Welt vollständig ist.
Zum Beispiel ist mein Vater gestorben. Aber ich erinnere mich nicht daran. Er hat sich 1986 in einem offenen Hubschrauber über den havarierten Tschernobyl-Reaktor fliegen lassen, um ein paar spektakuläre Urlaubsfotos zu machen. Nach der Entwicklung waren sie einheitlich weiß, von der harten Strahlung. Weißes, glänzendes Fotopapier. Das ist alles, woran ich mich erinnere.
Ursprünglich bin ich zum Arzt gegangen, weil ich ständig alles vollgeschrieben habe. Der Arzt hat mich dann zum Psychologen geschickt, der Psychologe zum Neurologen.
Wenn etwas Raum fordert, dann beansprucht es Wirklichkeit, und ich hätte nicht gedacht, dass etwas, das unsichtbar im Schädel liegt und keine Schmerzen bereitet, so viel davon einnehmen könnte. Genaugenommen alle Wirklichkeit, die es gibt. Die Bilder, die Doktor Sandmann vor mich auf den Tisch gelegt hat, zeigen ein perfektes, weißes Ei, etwa so groß wie meine Daumenkuppe, links hinter dem Ohr. Der Schläfenlappen ist betroffen, er steht unter Druck, daher
die Hypergrafie. Das heißt: Ich beschreibe, was immer mir in die Finger kommt, Papier, alte Einkaufszettel, die Seitenränder von Büchern, Klopapier, meine eigenen Beine. Auch jetzt: Mit der Linken steuere ich den Wagen, die Rechte führt den Stift über die
Heftseiten auf dem Beifahrersitz. Ich kann es schon ohne hinzusehen, und es ist auch egal, ob ich mit rechts oder mit links schreibe. Ich fühle mich verdammt und auserwählt zugleich, und kurz durchzuckt mich der Impuls, das einfach abzustellen, indem ich einen andern Weg aus dem Tunnel nehme. Einfach kurz das Steuer verreißen. Ach so, sagte ich das schon?
Jedenfalls – die Wände des Tunnels sind damit nicht einverstanden. Sie ziehen sich ins Dunkel zurück, weiten sich zu einer Höhle. Und dann stürzt auch schon Licht auf mich ein. Der Tunnel ist zu Ende, ich bin im Freien.
Der Wagen gleitet über die Straße, links grüne Hügel, Schafe, rechts Sand, die Luft flimmert wie in der Wüste, und darunter polierter Stahl, ich weiß gar nicht, wo der Strand aufhört, wo das Wasser beginnt und ob es überhaupt wirklich Wasser ist oder nur eine Luftspiegelung. Ich will diese Fläche betreten, versuchen, ob das
Wasser mich trägt. Wenn es so hart ist, wie es aussieht, müsste ich darauf laufen können, und das würde beweisen, dass ich unsterblich bin. Anhalten, aussteigen, Schuhe im Wagen lassen, Hose hochkrempeln. Ich glaube eben doch nicht daran.
Die Luft steht, nicht einmal das Plitschen kleiner Wellen ist zu hören. Ich rieche warme Haut, Salz. Und Honig. Obwohl weit und breit niemand zu sehen ist. Aber der Geruch ist deutlich, sogar fast vertraut. Das Wasser hat sich weit zurückgezogen, der Sand ist platt und fest, weißblaugoldene Unendlichkeit vor mir, und je weiter ich gehe auch immer mehr rechts und links von mir.
Wenn ich mich jetzt umdrehe, werde ich hinter mir dasselbe sehen. Oder besser: nichts mehr sehen. Keine Grenzen, die ganze Welt nur weißblaugoldener Raum, in alle Richtungen, auch oben und unten, das Auto wird nicht mehr da sein, die Hügel, die Straße. Wenn ich mich jetzt umdrehe und in alle Richtungen nichts mehr da ist, dann gehe ich einfach immer weiter geradeaus.
Nein. Da ist der Wagen, ziemlich weit weg, aber er ist da. Und die Hügel sind da, die Straße. Ich bleibe stehen, warte auf eine Eingebung, eine Entscheidung. Kleine Wellen beginnen an meinen Füßen zu nesteln, irgendwie nervös. Ja ja, ich weiß, die Flut kommt, ich sollte gehen.
An der Grenze zwischen Wasser und Sand kommt jemand auf mich zu, eine Frau, ausufernde Formen, watschelnder Gang, ein schwarzes Basecap auf dem Kopf, dünnes graues Haar, das hinter ihr herweht wie ein zerzauster Wimpel, Blick aufs Meer gerichtet, und hinter ihr, irgendwie blass und verwaschen, trottet ein großer
Hund. Auch dieses Bild vage bekannt, wie der Geruch. Nur beinahe da, nur beinahe vertraut. Ich will niemandem begegnen, will keinen Guten Tag wünschen müssen, beeile mich, zur Straße zurückzukehren. Danke, Wellen.
Der Wagen hat sich in der Sonne aufgeheizt, das mit Kunstleder bezogene Lenkrad rutscht mir durch die Hände. Die Straße windet sie sich ein paar Meilen ins Land hinein, Schafe, Schafe, dickfellige Ponys, miesepetrige Möwen und dann wieder Strand. Ich erkenne die Felsen, die weiter draußen aus dem Wasser ragen, schwarze, wilde Dinger, mit Höhlen, die bei Flut unter und bei Ebbe über Wasser liegen. Laut Reiseführer liegt irgendwo dort draußen der heilige Gral versteckt, und es müsste nun bald ein Hinweisschild kommen, immer direkt nach der nächsten Kurve müsste es sein: Camping Site Golden Dawn.
Ähnliche Produkte
Phantastische Bibliothek
Phantastische Bibliothek
Science Fiction allg. Reihe
Phantastische Bibliothek
Phantastische Bibliothek
Science Fiction allg. Reihe
Phantastische Bibliothek
Phantastische Bibliothek



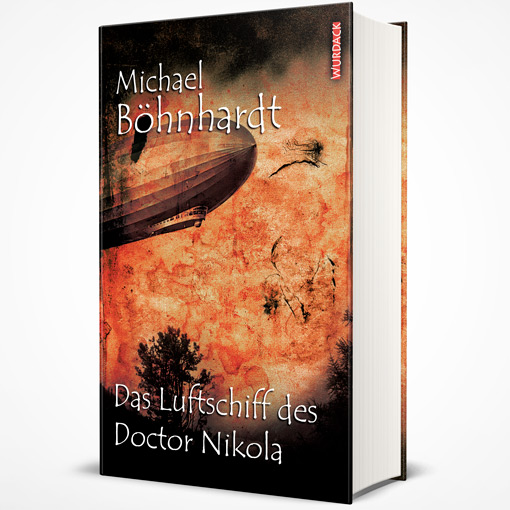
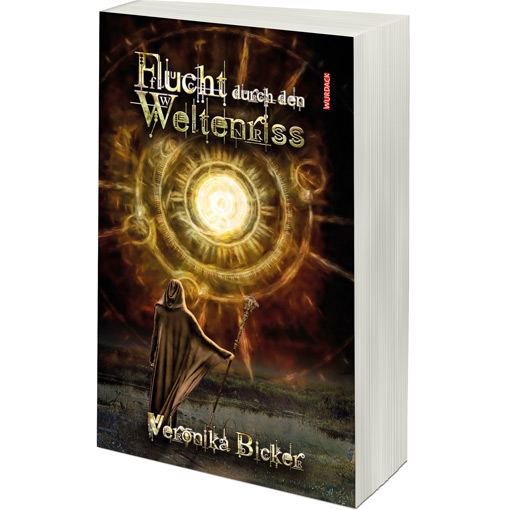

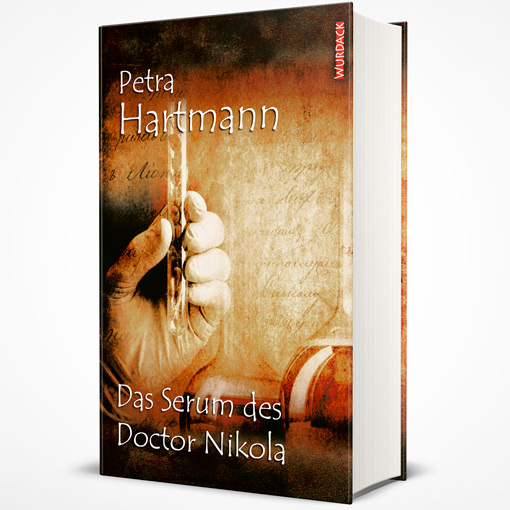


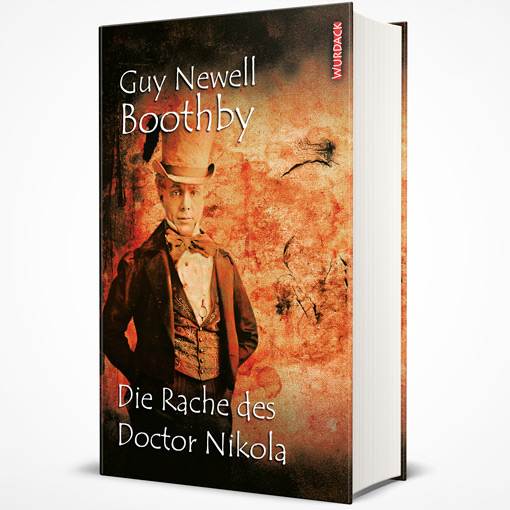
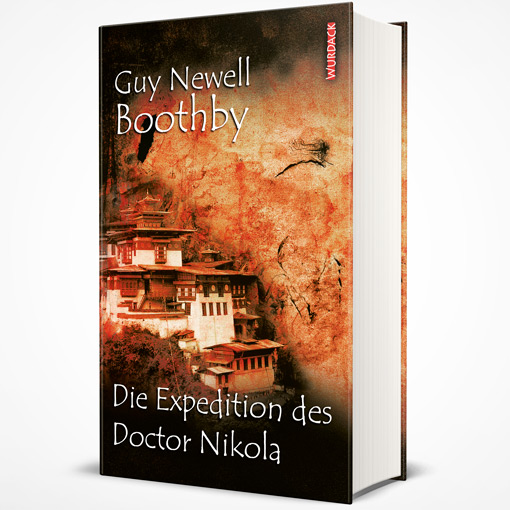
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.